
Kinder spielen und begegnen sich autonom im öffentlichen Raum. © @illustriert.ch
24 gennaio 2025
Nadine Junghanns | Da un punto di vista personale
Kinderfreundliche Baukultur – so gelingt’s
Eine kinderfreundliche Baukultur anerkennt und berücksichtigt die besonderen Anliegen von Kindern und Jugendlichen an den Raum. Gelingt dies, entstehen Städte und Gemeinden, die sich durch hohe Lebensqualität, Nachhaltigkeit und an den Klimawandel angepasste Räume auszeichnen. Dazu müssen wir Kinder und Jugendliche selbst und mit einer stellvertretenden Interessenvertretung an den Planungs- und Bauprozessen beteiligen.
Wie zeichnet sich eine kinderfreundliche Baukultur aus?
In einer Stadt oder einer Gemeinde mit einer kinderfreundlichen Baukultur können sich Kinder und Jugendliche autonom und sicher im öffentlichen Raum aufhalten und bewegen. Ermöglicht wird dies in autoarmen Städten und Gemeinden, die dem Fuss- und Veloverkehr bei Planung, Bau und bei der Nutzungsregelung Vorrang geben. Wenn Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum unterwegs sind, brauchen sie qualitativ hochwertige Naturräume, Spielräume und Begegnungsräume. In einer Stadt oder einer Gemeinde mit einer kinderfreundlichen Baukultur sind diese Räume miteinander vernetzt und barrierefrei für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich. Damit Kinder und Jugendliche Selbstwirksamkeit erfahren und schliesslich zu selbstbewussten Menschen heranwachsen, brauchen sie veränderbare Räume, in denen nicht alles in Stein gemeisselt und in Beton gegossen ist. In veränderbaren Räumen treten Kinder und Jugendliche miteinander in Kontakt und entwickeln Kreativität sowie soziale Kompetenzen. Erreicht werden kann dies beispielsweise durch die Nutzung von vielfältigen Naturmaterialien bei der Gestaltung von öffentlichen Plätzen, Wegrändern oder Natur- und Spielräumen. Insbesondere Jugendliche finden unkommerzielle Treffpunkte im öffentlichen Raum. Kinder, Jugendliche und kommende Generationen werden in einer Welt leben, die mindestens in einem gewissen Ausmass von den Folgen des Klimawandels geprägt ist. Da Kinder und Jugendliche besonders sensibel gegenüber übermässiger Hitze sind, zeichnet sich eine kinderfreundliche Baukultur durch die umfassende Nutzung kühlend wirkender Elemente bei der Planung und Gestaltung des öffentlichen Raums aus. Auch Bauten wie Wohnhäuser, Schulhäuser usw. sind nachhaltig geplant und an den Klimawandel angepasst.
Und wie wird das nun erreicht?
Kinder und Jugendliche haben im Vergleich zu den Erwachsenen weniger Möglichkeiten, sich für die Umsetzung ihrer Rechte einzusetzen. Über die Raum- und Baupolitik wird grossenteils in Wahlen und Abstimmungen entschieden, an denen sie nicht partizipieren dürfen. Wenn es um die Planung und Umsetzung konkreter Projekte geht, werden Kinder und Jugendliche nur sehr selten einbezogen. Auch gibt es nur selten eine stellvertretende Interessenvertretung. Gibt es bei einem Projekt ein Beteiligungsverfahren, dann ist dieses oftmals nicht auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet.
Kinder und Jugendliche haben aber das Recht, bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, einbezogen zu werden. Da der öffentliche Raum die direkte Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen darstellt, ist es zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention unabdingbar, Kinder und Jugendliche in die Planung, Gestaltung und Nutzungsregelung des öffentlichen Raums direkt oder mittels anwaltschaftlicher Vertretung einzubeziehen. Das gilt nicht nur für Spielplätze und Pausenplätze, sondern auch, wenn es darum geht, viel befahrene Strassen und grosse Kreuzungen neu zu planen, oder bei Ortsplanungsrevisionen, kommunalen Richtplänen und Dorfkernerneuerungen. Ein ernsthafter Einbezug erfordert altersgruppengerechte und differenzierte Methoden, zeitliche Ressourcen und Flexibilität von Erwachsenen. Werden die Anliegen der Kinder und Jugendlichen erkannt und berücksichtigt, steht am Ende oftmals ein besseres Ergebnis, dessen Merkmale allen Generationen zugutekommen.
Und wer muss dafür einstehen?
Die Steigerung der Kinderfreundlichkeit im öffentlichen Raum ist eine Querschnittsaufgabe zahlreicher Akteurinnen und Akteure der öffentlichen Hand und von privaten Trägerschaften. Die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteurinnen und Akteure zu institutionalisieren, ist eine wichtige Voraussetzung, um Kinderrechte im Verkehrsraum zu realisieren. Zentral ist dabei auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Bau- und Planungsämtern und den Ämtern und Stellen, die direkt mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Wie das gelingen kann und welche Aufgaben die einzelnen Akteurinnen und Akteure dabei haben, zeigt UNICEF Schweiz und Liechtenstein im Handbuch «Planung und Gestaltung von kinderfreundlichen Lebensräumen» und in der Publikation «Kinderfreundlicher Verkehrsraum». Begleitet werden die Publikationen von einer Sammlung von Fallbeispielen zur Umsetzung kinderfreundlicher Lebensräume.
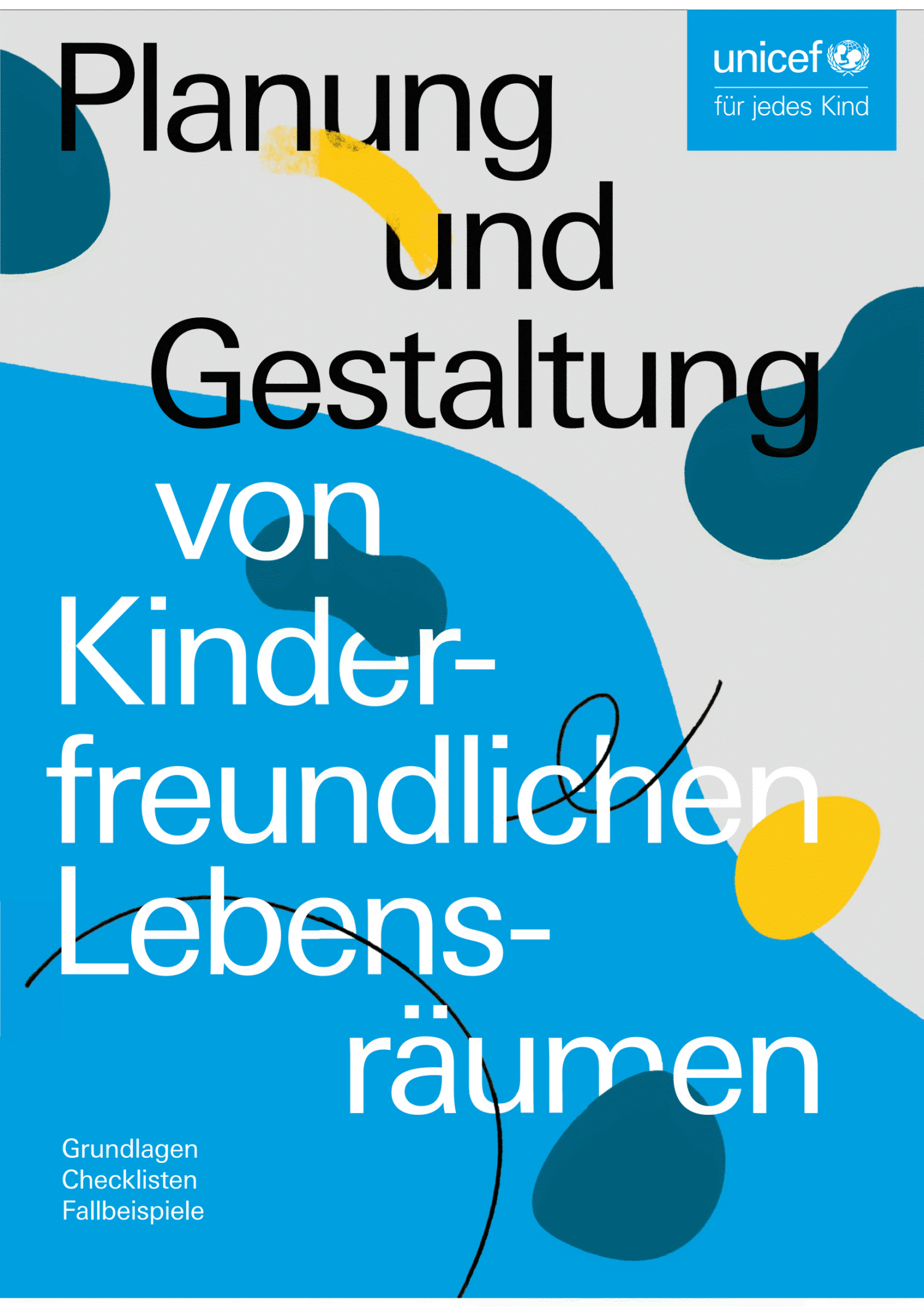

Nadine Junghanns
Nadine Junghanns, *1986 in Hamm (D), ist Spezialistin für kinderfreundliche Lebensräume bei UNICEF Schweiz und Liechtenstein. Dabei beschäftigt sie sich massgeblich mit der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes bei der Planung und Gestaltung des öffentlichen Raums. Nadine Junghanns studierte Klimawissenschaften an der Universität Bern und hält einen Master of Sciences in Climate Sciences. www.unicef.ch


